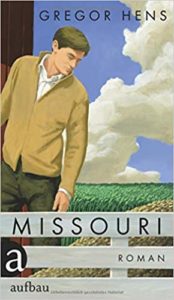 Letzte Woche war ich in Berlin. Maike Albath hat im LCB den sehr klugen neuen Roman von Gregor Hens mitsamt seinem Autor präsentiert, und weil Gregor Hens außerdem Übersetzer ist, waren als zusätzliche Gesprächspartner Frank Heibert und ich dabei. Der Abend wird am Samstag, dem 23. Februar ab 20:00 Uhr im Deutschlandfunk ausgestrahlt.
Letzte Woche war ich in Berlin. Maike Albath hat im LCB den sehr klugen neuen Roman von Gregor Hens mitsamt seinem Autor präsentiert, und weil Gregor Hens außerdem Übersetzer ist, waren als zusätzliche Gesprächspartner Frank Heibert und ich dabei. Der Abend wird am Samstag, dem 23. Februar ab 20:00 Uhr im Deutschlandfunk ausgestrahlt.
Die nächste Jane Gardam ist fertig und erscheint schon im Mai. Eigentlich hätte sie ein bisschen früher fertig sein sollen, aber dann bin ich eine Woche lang auf dem gebrochenen Fuß von einem Arzt zum anderen gerannt und kam nicht zum Übersetzen, was blöd war, denn noch eigentlicher muss ich dringend schreiben.
Aber jetzt ist sie fertig, letzte Woche Samstag habe ich das letzte Kapitel weggeschickt, und die Korrekturen kamen dann auch schon am Montag Mittag zurück, weil ich den Rest schon vorher abgegeben hatte. Montag Abend hatte ich sie durchgeguckt und zack.
Dienstag bin ich nach München gefahren, das war schön, weil Simone zufällig am gleichen Tag nach München fuhr und wir einfach mal fünf Stunden Zeit hatten.
Nachmittags im Hotel habe ich mit der Lektorin telefoniert und letzte Fragen geklärt, und damit ist der Keks jetzt auch wirklich gegessen, und ich habe den Kopf frei für meinen eigenen Roman.
In München war ich einen Tag zu früh, meine Lesung dort war erst am Mittwoch. Aber ich fand, ein ganzer Tag Anreise, abends Bühne, und am nächsten Tag schon wieder den ganzen Tag in der Bahn klang nicht so verlockend, also bin ich früher hin und wollte einfach mal einen Tag gemütlich durch München stromern. Was ja an sich eine gute Idee gewesen wäre, aber halt nicht mit einem gebrochenen Fuß. Der allerdings auch dramatischer klingt, als er ist. Ich habe also ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt, kurz ein bisschen gelesen, dann bin ich doch zu Fuß durch den Englischen Garten zu meiner Mittagessenverabredung gegangen und danach auch zu Fuß wieder zurück. Denn Fußkaputt hin oder her, nach drei Wochen Dauerschreibtisch und Fußhochlegen hatte ich dringend das Bedürfnis nach frischer Luft und Bewegung. Geht auch gut mit dem flotten Vorfußentlastungsschuh. Dann Mittagsschläfchen und abends Jane-Gardam-Veranstaltung mit Jo Lendle im Literaturhaus.

(Es war natürlich ein hochseriöser und sehr ernsthafter Abend. Foto: Amelie Fried)
Am nächsten Tag bin ich weitergefahren nach Berlin. Kein und Aber hatte zum Buchhändlerabend mit Max Porter eingeladen, und nachdem ich sein letztes Buch so toll fand und darüber gebloggt hatte, haben sie ein Zitat von mir auf die Rückseite des neuen Romans gesetzt und mich deswegen zu diesem Essen eingeladen. Das hat mir geschmeichelt, und es war total nett, mit Feuer draußen und leckerem Essen drinnen und dann wieder Lesung am Feuer draußen und lauter netten Berliner BuchhändlerInnen und anderen.
Freitag hatte ich noch eine Frühstücksverabredung in Berlin, bin dann nach Hause gefahren und habe abends im Büchereck Niendorf gelesen. Heute Nachmittag dann noch eine Lesung bei Boysen und Mauke, Zusammenbruch in … drei … zwei …

(Schon wieder dasselbe Kleid. Hab ich neu. Foto: Martin Paas)
Quatsch, geht schon. Morgen bin ich noch auf einem Geburtstag eingeladen, und ab Montag muss ich mich dann dringend an meinen Roman setzen. Richtig dringend. Ich habe Anmerkungen von meiner Agentin, meiner Lektorin und einem Freund bekommen, die muss ich jetzt kollationieren und alles ineinanderfrickeln und meine eigenen Notizen noch mal sichten und so weiter. Ende des Monats fahren wir wieder zu dritt zehn Tage in Schreibklausur, und da muss es dann mal langsam zum Ende kommen. Ich bin inzwischen ziemlich unter Druck, irgendwann Anfang März muss es fertig sein, und das ist ungefähr übermorgen. Wir haben jetzt einen Titel, das Cover ist in Arbeit, Erscheinungstermin ist irgendwann im September, es gibt sogar schon einen Premierentermin (ich sage rechtzeitig Bescheid), es ist alles ganz schön aufregend.
Hat jemand mein Superheldinnencape gesehen?
Immer wieder überraschend, was man beim Übersetzen so lernt: Eine Hand of Glory ist die abgehackte Hand eines Menschen (genauer gesagt: eines Erhängten). Wenn man sich als Einbrecher Zutritt zu einem Haus verschafft hat, kann man, wenn alle anderen im Haus schlafen, eine Kerze in diese Hand stecken (ich erspare Euch die Zutaten, aus denen die Kerze herzustellen ist), und mit folgender Beschwörung dafür sorgen, dass alle im Haus sehr fest schlafen und nur der Einbrecher hübsch wachbleibt:
Let those who rest more deeply sleep,
Let those awake their vigil keep.
Oh hand of Glory, shed thy light,
Direct us to our spoil tonight.
Alsdann ruft der Einbrecher in meiner Geschichte mithilfe der leuchtenden Hand seine Bande zusammen, die draußen wartet:
Flash out thy light, oh skeleton hand,
And guide the feet of our trusty band.
Ich bin mit meinen Versuchen bis hier gekommen:
Lass die, die schlafen, tiefer ruhn,
und die, die wach sind, hellwach sein.
Hand des Lichts, wirf deinen Schein
Auf unsre reiche Beute nun.
Wirf dein Licht, du Leichenhand
Und zeig den Weg der Räuberband’.
… aber noch gar nicht glücklich. Na los, Ihr seid doch besser als ich.
Das erste Buch, das ich übersetzt habe, hieß „Gärten auf kleinstem Raum. Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang.“ Nicht wirklich mein Thema, aber es war der Moment, in dem ich zum ersten Mal in meinem Leben dachte: Das ist es, was ich machen will. Ich will Bücher übersetzen. Da habe ich ein bisschen Zeit, mich in ein Thema einzuarbeiten, kann mit der Sprache arbeiten, und am Ende habe ich ein Produkt in der Hand, das schön aussieht und in dem mein Name drinsteht. Das will ich machen. An Literatur habe ich damals noch nicht gedacht, Literatur war etwas „Großes“, was große Leute machten, die etwas konnten. Ich doch nicht. Aber ich wollte übersetzen, und ich hatte das Gefühl, dass ich darin eines Tages ganz gut werden könnte. Dass es mir liegt und mir Spaß macht. Und dass ich gut werden wollte. Ich hatte zum ersten Mal im Leben Ehrgeiz.
Der Übersetzerverband nahm einen damals erst auf, wenn man schon zwei Bücher übersetzt hatte. Mein zweites hieß „Selbstgemachte Kerzen und Potpourris“. Sobald ich es fertig hatte, trat ich in den VdÜ ein und bewarb mich auch sofort auf mein erstes Seminar: Sachbuchübersetzen bei Irene Rumler und Klaus Stadler. Das Seminar fand im Europäischen Übersetzerkollegium in Straelen statt, und ich war komplett geflasht. Erstens davon, dass es da ein Arbeitszentrum für Übersetzer gibt, wo man für eine begrenzte Zeit wohnen und arbeiten kann und die größte Übersetzer-Spezialbibliothek der Welt zur Verfügung hat. Und Kolleginnen, die ebenfalls übersetzen. Und dann natürlich vom Seminar, mit richtigen Übersetzerinnen, die teilweise schon zehn Bücher oder so übersetzt hatten, und zwar richtige! Nicht nur so Potpourriquatsch. Ich telefonierte jeden Abend mit dem lustigen Mann und blubberte ihn stundenlang voll damit, was ich alles Tolles gelernt hatte und wie großartig alles war.
Seit diesem Seminar wartete ich darauf, ein Buch zum Übersetzen zu bekommen, mit dem ich mich ins EÜK traute, ohne Seminar, um dort einfach an meiner eigenen Übersetzung zu arbeiten. Nach ein paar eher unaufregenden Jugendsachbüchern bekam ich einen sehr schönen Bildband über Bar- und Clubdesign. Das war doch etwas Vorzeigbares, fand ich, und fuhr für zwei Wochen zum Arbeiten nach Straelen.
Eine der ebenfalls dort arbeitenden Kolleginnen war Maria Csollány. „Die Mau“. Sie hat mir sofort das Du und das „Mau“ angeboten, wir waren ja Kolleginnen und ich ganz gerührt, dass sie das so sah. Eine ältere Dame, die für ihre Lyrik-Übersetzungen aus dem Niederländischen gerade erst den Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie bekommen hatte. Eine große alte Dame. Eine kleine alte Dame mit einem sehr feinen, leisen Humor und einer unglaublich liebevollen Zugewandtheit und großem Interesse an mir jungem Hüpfer. Ich gestand, dass ich mich kaum hergetraut hatte, mit meinen popeligen Potpourribüchern, wo doch lauter so große Leute wie sie dawaren. „Ach, weißt du“, sagte sie, „ich habe in den siebziger Jahren angefangen mit Büchern über Makramee und Kochen aus der Tiefkühltruhe.“
Jetzt ist Maria Csollány im Alter von 86 Jahren gestorben.
Gute Reise, Mau. Wir haben uns danach nur noch ein, zweimal irgendwo gesehen, aber ich habe immer wieder an dich gedacht. Wie viel Mut mir dieser kleine Satz gemacht hat.
Einer der abgedroscheneren Sätze der Literaturgeschichte. Kommt in allen Genres und in den besten Familien vor, wie die taz hier so schön darlegt. Im Gegensatz, beispielsweise, zum ebenso abgedroschenen „Es war, als hätte jemand ein Licht in ihr angezündet“, das ist eindeutig eine Liebesschnulze oder Chick-Lit, und es ist Kitsch.
Aber der Satz mit dem Hund – wahlweise auch: „In der Ferne bellte ein Hund“ –, geht immer und überall, und er ist natürlich an sich erstmal kein Kitsch, sondern so voll atmosphärisch dicht und so, aber man hat ihn halt ein paarmal zu oft gelesen. Herr TWSchneider hat mir auf Facebook, weil ebendieser Satz in Jane Gardams Letzte Freunde steht, einen kleinen Seitenhieb verpasst, der mich jetzt schon seit gestern beschäftigt, denn es stellt sich ja in der Tat die Frage: Was macht denn die Übersetzerin, wenn im Original steht:
A lost dog barking out of sight.
Schreibt man da: „In weiter Ferne war das Bellen eines einsamen Hundes zu hören“, nur um nicht „Irgendwo bellte ein Hund“ zu schreiben? Ich meine: Nein. Denn da liest man ja laut und deutlich „die Übersetzerin wollte wohl nicht ‚Irgendwo bellte ein Hund‘ schreiben“ mit. Oder? Da muss man doch erst recht „Irgendwo bellte ein Hund“ schreiben und hoffen, dass jeder Leser kapiert, dass das ein Zitat ist oder eine Art Running Gag der Weltliteratur und nur ironisch gemeint sein kann. Das denke ich, und das hoffe ich, und ich hoffe außerdem, dass Jane Gardam einen solchen Satz auch nicht ganz ohne Augenzwinkern meinen kann. Gleichzeitig weiß ich genau, dass es als Scherz nicht funktioniert.
Es ist nämlich so: Im Pfau kommt der Satz „Irgendwo blökte ein Schaf“ vor. Den habe ich jetzt auf knapp 60 Lesungen vorgelesen, und es hat noch nie jemand gelacht. Einer von zwei Gags, die noch kein einziges Mal funktioniert haben. Und jetzt? Mal meinen eigenen Humor überdenken? Oder bei nächster Gelegenheit noch deutlicher werden, wie etwa Jo Lendle, der in „Was wir Liebe nennen“ schreibt:
In der Ferne bellte kein Hund.
Großartiger Satz, ich habe laut gelacht, aber es geht halt ein bisschen die Subtilität flöten. Oder gar die Subversivität. Ist es subversiv, einen Satz zu schreiben, der einfach überhaupt nicht (mehr) geht? Oder fällt das nur unter „Witze, die niemand kapiert“? Ich weiß es nicht.
Vor einer ähnlichen Frage steht man übrigens bei der Neuübersetzung von Klassikern. Was macht man mit ikonischen Sätzen? Was macht man, wenn man den kleinen Prinzen neu übersetzt, aus „man sieht nur mit dem Herzen gut usw“ – macht man das krampfhaft irgendwie anders? Oder lässt man es so, weil der Satz ja gut ist, wie er ist? Die einen so, die anderen so, klar. Keine Ahnung, was ich täte. Vermutlich würde ich es bei der etablierten Version belassen, denn irgendwann gilt so ein Satz ja als „richtig“.
Mal sehen, vielleicht kriege ich ja im nächsten Roman ein „Irgendwo schrie ein Pfau“ unter.
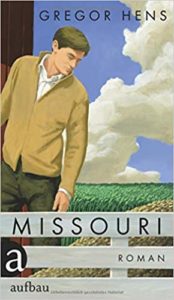 Letzte Woche war ich in Berlin. Maike Albath hat im LCB den sehr klugen neuen Roman von Gregor Hens mitsamt seinem Autor präsentiert, und weil Gregor Hens außerdem Übersetzer ist, waren als zusätzliche Gesprächspartner Frank Heibert und ich dabei. Der Abend wird am Samstag, dem 23. Februar ab 20:00 Uhr im Deutschlandfunk ausgestrahlt.
Letzte Woche war ich in Berlin. Maike Albath hat im LCB den sehr klugen neuen Roman von Gregor Hens mitsamt seinem Autor präsentiert, und weil Gregor Hens außerdem Übersetzer ist, waren als zusätzliche Gesprächspartner Frank Heibert und ich dabei. Der Abend wird am Samstag, dem 23. Februar ab 20:00 Uhr im Deutschlandfunk ausgestrahlt. 
