Gelesen (ab 2009):
Adiga, Aravind (Ingo Herzke): Der weiße Tiger
Adorján, Johanna: Eine exklusive Liebe
Aigner, Korbinian: Äpfel und Birnen. Das Gesamtwerk
Bakker, Gerbrand (Andreas Ecke): Oben ist es still
Bakker, Gerbrand (Andreas Ecke): Juni
Bakker, Gerbrand (Andreas Ecke): Komische Vögel
Baum, Andreas: Wir waren die neue Zeit
Bechstein, Ludwig und Scheffler, Axel (Illustration): Der Verdrüßliche
Beck, Zoe: Das alte Kind
Bennett, Alan (Ingo Herzke): Die souveräne Leserin
Bennett, Alan (Brigitte Heinrich): Così fan tutte
Bennett, Alan (Ingo Herzke): Handauflegen
Bennett, Alan (Ingo Herzke): Vatertage
Bennett, Alan (Ingo Herzke): Die Lady im Lieferwagen
Bennett, Alan (Ingo Herzke): Schweinkram
Bjerg, Bov: Auerhaus
Bjerg, Bov: Die Modernisierung meiner Mutter
Böttcher, Jan: Nachglühen
Bräuer, Hermann: Haarweg zur Hölle
Brett, Lily (Melanie Walz): Chuzpe
Brink, André (Inge Leipold): Kupidos Chronik
Bronsky, Alina: Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche
Bronsky, Alina: Scherbenpark
Buchholz, Simone: Bullenpeitsche
Buchholz. Simone: Eisnattern
Buchholz, Simone: Blaue Nacht
Buchholz, Simone: Beton Rouge
Buchholz, Simone: Mexikoring
Budde, Nadia: Flosse, Fell und Federbett
Budde, Nadia: Such dir was aus, aber beeil dich!
Budde, Nadia: Unheimliche Begegnungen auf Quittenquart
Budde, Nadia: Und außerdem sind Borsten schön
Buddenbohm, Maximilian: Zwei, drei, vier. Wie ich eine Familie wurde
Buddenbohm, Maximilian: Es fehlt mir nicht, am Meer zu sein
Buddenbohm, Maximilian: Marmelade im Zonenrandgebiet
Busquets, Milena: Auch das wird vergehen
Cadeggianini, Georg: Aus Liebe zum Wahnsinn
von Canal, Anne: Der Grund
Carpenter, Louise (Miriam Mandelkow): Ida und Louise
Caspak, Victor / Lanois, Yves (Andreas Steinhöfel): Die Kurzhosengang
Cechov, Anton (Hertha von Schulz / Gerhard Dick): Die Dame mit dem Hündchen
Chopin, Kate: Das Erwachen
Coe, Jonathan (Walter Ahlers): Die ungeheuerliche Einsamkeit des Maxwell Sim
Cooper, T (Brigitte Jakobeit): Beaufort
Cottin, Menena / Faría, Rosana (Helga Preugschat): Das schwarze Buch der Farben
Davies, Adam (Hans M. Herzog): Froschkönig
Dorau, Andreas / Regener, Sven: Ärger mit der Unsterblichkeit
Duve, Karen: Weihnachten mit Thomas Müller
Duve, Karen: Thomas Müller und der Zirkusbär
Duve, Karen: Anständig essen
Elmiger, Dorothee: Einladung an die Waghalsigen
Erlbruch, Wolf: Ente, Tod und Tulpe
Erlbruch, Wolf: Frau Meier, die Amsel
Erpenbeck, Jenny: Heimsuchung
Eugenides, Jeffrey (M. Sandberg-Ciletti): Die Selbstmordschwestern
Evers, Horst: Für Eile fehlt mir die Zeit
Ferrante, Elena: Meine geniale Freundin
Fox, Paula (Ingo Herzke): Der kälteste Winter
Foer, Jonathan Safran : Tree of Codes
Fricke, Lucy: Ich habe Freunde mitgebracht
Fröhlich, Alexandra: Gestorben wird immer
Geiger, Arno: Der alte König in seinem Exil
Geiger, Arno: Alles über Sally
Glattauer, Daniel: Gut gegen Nordwind / Alle sieben Wellen
Glattauer, Daniel: Ewig Dein
Goldman, William (Wolfgang Krege): Die Brautprinzessin
Gravett, Emily: Little Mouse’s Big Book of Fears
Grjasnowa, Olga: Der Russe ist einer, der die Birken liebt
Gröner, Anke: Nudeldicke Deern
Grossman, David (Anne Birkenhauer): Eine Frau flieht vor einer Nachricht
Grossman, David (Michael Krüger): Die Umarmung
Haahtela, Joel (Sandra Doyen): Sehnsucht nach Elena
Haas, Wolf: Der Brenner und der liebe Gott
Haas, Wolf: Verteidigung der Missionarsstellung
Hansen, Dörte: Altes Land
Hagena, Katharina: Der Geschmack von Apfelkernen
Heiland, Henrike: Von wegen Traummann
Hein, Jakob: Herr Jensen steigt aus
Heinrich, Finn-Ole : Räuberhände
Herrndorf, Wolfgang: Tschick
Hustvedt, Siri (U. Aumüller, E. Fischer, G. Osterwald): Was ich liebte
Hustvedt, Siri (Uli Aumüller): Der Sommer ohne Männer
Iweala, Uzodinma (Marcus Ingendaay): Du sollst Bestie sein!
Jandl, Ernst / Junge, Norman: fünfter sein
Janisch, Heinz / Erlbruch, Wolf: Der König und das Meer
Jansson, Tove (Birgitta Kicherer): Herbst im Mumintal
Jansson, Tove (Birgitta Kicherer): Winter im Mumintal
Jansson, Tove (Birgitta Kicherer): Komet im Mumintal
Jensen, Carsten (Ulrich Sonnenberg): Wir Ertrunkenen
Jochimsen, Jess: Danebenleben
Johnson, Denis (Bettina Abarbanell): Train Dreams
Jonasson, Jonas (Wibke Kuhn): Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
Jones, Shane (Chris Hirte): Thaddeus und der Februar
July, Miranda (Clara Drechsler, Harald Hellmann): Zehn Wahrheiten
Jung, Sohyun: Vergiss nicht, das Salz auszuwaschen
Junk, Catharina: Auf Null. (Erscheint neu unter dem Titel „Liebe wird aus Mut gemacht“.)
Kawakami Hiromi (Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama-Ziegler): Herr Nakano und die Frauen
Kehlmann, Daniel: Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten
Kehlmann, Daniel: Ich und Kaminski
Khayat, Rasha: Weil wir längst woanders sind
Killen, Chris (Henning Ahrens): Das Vogelzimmer
Kinsky, Esther: Sommerfrische
Klüssendorf, Angelika: Das Mädchen
Klüssendorf, Angelika: April
Koch, Miriam: Keentied
Köhlmeier, Michael: Idylle mit ertrinkendem Hund
König, Ralf: Der bewegte Mann / Pretty Baby
Krüss, James: Mein Urgroßvater und ich
Krüss, James: Henriette Bimmelbahn
van der Kwast, Ernest: Fünf Viertelstunden bis zum Meer
Lachmann, Frank: Kann Spuren von Nüssen enthalten
Leine, Kim: Die Untreue der Grönländer
Leinen, Angela: Wie man den Bachmannpreis gewinnt
Leky, Mariana: Die Herrenausstatterin
Leky, Mariana: Liebesperlen
Lendle, Jo: Mein letzter Versuch, die Welt zu retten
Lendle, Jo: Was wir Liebe nennen
Lenz, Siegfried: Landesbühne
Lewitscharoff, Sibylle: Apostoloff
Lia, Simone (Ingo Herzke): Marcus
Lobo, Sascha: Strohfeuer
Loe, Erlend (Hinrich Schmidt-Henkel): Naiv. Super.
Loe, Erlend (Hinrich Schmidt-Henkel): Jens. Ein Mann will nach unten.
Mee, Arthur (Hrsg), Axel Scheffler (Illustration), Harry Rowohlt (Übersetzung): Über das Halten von Eichhörnchen
Merrill Block, Stefan (Marcus Ingendaay): Wie ich mich einmal in alles verliebte
Metzger, Jochen: Und doch ist es Heimat (Hier nicht besprochen, aber unfassbar gut, bitte alle lesen!)
Meyer, Thomas: Trennt euch!
Moster, Andreas: Wir leben hier, seit wir geboren sind
Mundt, Angélique: Erste Hilfe für die Seele. Einsatz im Kriseninterventionsteam
Murakami Haruki (Ursula Gräfe): Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede
Murgia, Michela (Julika Brandestini): Accabadora
Neale Hurston, Zora (Hans-Ulrich Möhring): Vor ihren Augen sahen sie Gott
Neeman Romascano, Silvie (Claudia Steinitz): Nichts ist geschehen
Nicholls, David (Simone Jakob): Zwei an einem Tag
Niemann, Christoph: Abstract City
Novák, Jan: Zátopek
Oates, Joyce Carol (Silvia Morawetz): Niagara
Ohlbaum, Isolde: Auswärtsspiele. Autoren unterwegs
Ohmura, Tomoko: Bitte anstellen
Olfers, Sibylle von: Etwas von den Wurzelkindern
Ondaatje, Michael (Melanie Walz): Katzentisch
Øyehaug, Gunnhild (Ebba Drolshagen): Ich wär gern wie ich bin
Özdogan, Selim: Die Tochter des Schmieds
Parei, Inka: Die Schattenboxerin
Paul, Stevan: Monsieur, der Hummer und ich
Pásztor, Susann: Ein fabelhafter Lügner
Pásztor, Susann: Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts
Pásztor, Susann: Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
Pehnt, Anette: Insel 34
Pletzinger, Thomas: Bestattung eines Hundes
Pletzinger, Thomas: Gentlemen, wir leben am Abgrund
Poladjan, Katerina: In einer Nacht, woanders
Porter, Max (Uda Strätling, Matthias Göritz): Trauer ist das Ding mit Federn
Posch, Alexander: Sie nennen es Nichtstun
Rai, Edgar: Nächsten Sommer
Rai, Edgar: Etwas bleibt immer
Rai, Edgar: Halbschwergewicht
Rammstedt, Tilman: Erledigungen vor der Feier
Rammstedt, Tilman: Wir bleiben in der Nähe
Rammstedt, Tilman: Der Kaiser von China
Rammstedt, Tilman: Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters
Rammstedt, Tilman: Morgen mehr
Randt, Leif: Schimmernder Dunst über CobyCounty
Rank, Elisabeth: Und im Zweifel für dich selbst
Rank, Elisabeth: Bist du noch wach?
Regener, Sven: Meine Jahre mit Hamburg-Heiner. Logbücher
Rinke, Moritz: Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel
Rinke, Moritz: Also sprach Metzelder zu Mertesacker
Rothmann, Ralf: Feuer brennt nicht
Rowling, Joanne K. (Klaus Fritz): Harry Potter und der Stein der Weisen
Rowling, Joanne K. (Klaus Fritz): Harry Potter und die Kammer des Schreckens
Rowling, Joanne K. (Klaus Fritz): Harry Potter und der Gefangene von Askaban
Rowling, Joanne K. (Klaus Fritz): Harry Potter und der Feuerkelch
Schalansky, Judith: Atlas der abgelegenen Inseln
Schalansky, Judith: Matrosenroman
Schalansky, Judith: Der Hals der Giraffe
Schilbach, Friederike (Hg): The Bathroom Chronicles
Schmeißer, Frank: Schurken überall!
Schmeißer, Frank: Schurken am Ball!
Schmeißer, Frank: Jungs sind keine Hamster
Schmidt, Jochen: Schneckenmühle
Schmidt, Kathrin: Du stirbst nicht
Schubiger, Jürg / Erlbruch, Wolf: Zwei, die sich lieben
Seethaler, Robert: Der Trafikant
Seethaler, Robert: Ein ganzes Leben
Seddig, Katrin: Runterkommen
Seddig, Katrin: Eine Nacht und alles
Shapton, Leanne (Rebecca Casati): Bedeutende Objekte und persönliche Besitzstücke aus der Sammlung von Lenore Doolan und Harold Morris, darunter Bücher, Mode und Schmuck
Simenon, Georges (Trude Fein): Der kleine Heilige
Skomsvold, Kjersti A.: Je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich
Smith, Lane (Michael Krüger): Das ist ein Buch!
Smith, Zadie (Hg.): Das Buch der anderen (Anthologie)
Straub, Johanna: Das Beste daran
Strout, Elizabeth (Sabine Roth): Mit Blick aufs Meer
Taylor, Kressman (Dorothee Böhm): Adressat unbekannt
Taylor, Kressman (Marion Hertle): So träumen die Frauen
Tellegen, Toon und Scheffler, Axel (Mirjam Pressler): Briefe vom Eichhorn an die Ameise
Tobor, Alexandra: Sitzen vier Polen im Auto
Töpffer, Rodolphe: Die Abenteuer der Herrn Cryptogam
Torday, Paul (Thomas Stegers): Charlie Summers
Treichel, Hans-Ulrich: Der Verlorene
Treichel, Hans-Ulrich: Grunewaldsee
de Velasco, Stefanie: Tigermilch
Vištica, Olinka und Dražen Grubišić (Marcus Gärtner): Das Museum der zerbrochenen Beziehungen
Viel, Tanguy (Hinrich Schmidt-Henkel): Das absolut perfekte Verbrechen
Wieland, Rayk: Ich schlage vor, dass wir uns küssen
Williams, Robert (Brigitte Jakobeit): Luke und Jon
Winnemuth, Meike: Das große Los
Würger, Takis: Der Club
Yapp, Nick (Madeleine Lampe): Audrey Hepburn
Yglesias, Rafael (Cornelia Holfelder-von der Tann): Glückliche Ehe
Ziefle, Pia: Suna
Ziefle, Pia: Länger als sonst ist nicht für immer
Zehn Gebote des Schreibens
_______________________________
Was vorher war: Lektüre 2008, 2007, 2006
Veröffentlichungen
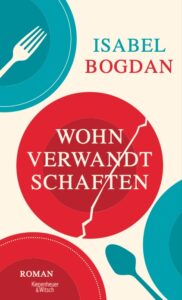
Wohnverwandtschaften
Ein Roman über eine Wohngemeinschaft, in der vier Menschen unterschiedlichen Alters aus unterschiedlichen Motiven zusammenleben und feststellen: Freunde sind manchmal die bessere Familie.
Constanze zieht nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten in die Wohngemeinschaft von Jörg, Murat und Anke. Was zunächst als Übergangslösung gedacht war, entpuppt sich als zunehmend stabil. Da ist Jörg, dem die Wohnung gehört und der mit seinem Bulli eine große Reise plant; Anke, die als mittelalte Schauspielerin kaum noch gebucht wird und plötzlich nicht mehr die einzige Frau in der WG ist; und Murat, der sich einfach keine Sorgen machen will und dessen Lebenslust auf die anderen mitreißend und manchmal auch enervierend wirkt. Constanze sorgt als Neuankömmling dafür, dass sich die bisherige Tektonik gehörig verschiebt. Alle vier haben ihre eigenen Träume und Sehnsüchte und müssen sich irgendwann der Frage stellen, ob sie eine reine Zweck-WG sind oder doch die Wahlfamilie.
In diesem virtuos komponierten, lebensklugen und humorvollen Roman kommen reihum vier grundverschiedene Menschen zu Wort, die jeweils auf ihre Weise ihre Lebensentwürfe neu justieren müssen.

Mein Helgoland
Wo beginnt eine Insel – und wo ein Roman?
Mit Helgoland verbindet Isabel Bogdan eine innige Schreibbeziehung. Oft schon ist sie in Hamburg auf den Katamaran gestiegen, der sie zu »Deutschlands einziger Hochseeinsel« bringt. Denn dort, mit Rundumblick aufs Meer, schreibt es sich viel besser als am heimischen Schreibtisch (wo sie dafür problemlos übersetzen kann). Doch warum ist das so? Nähert man sich einer Geschichte auf dieselbe Weise, wie man eine Insel für sich entdeckt? Auf welcher Seite der Insel beginnt man – und wie findet man in einen Roman?
Isabel Bogdan erzählt nicht nur von den Besonderheiten kleiner Inselgemeinden, von Helgolands wechselvoller Historie, von seltenen Vögeln oder Geheimrezepten gegen Seekrankheit.Vielmehr spannt sie den Bogen vom Schaffen des berühmtesten Helgoländer Geschichtenerzählers James Krüss zu der Frage, was gutes Erzählen eigentlich ausmacht und ob man es erlernen kann.
 Laufen
Laufen
Isabel Bogdan überrascht mit einem Roman über eine Frau, die nach einem Schicksalsschlag um ihr Leben läuft.
Eine Ich-Erzählerin wird nach einem erschütternden Verlust aus der Bahn geworfen und beginnt mit dem Laufen. Erst schafft sie nur kleine Strecken, doch nach und nach werden Laufen und Leben wieder selbstverständlicher. Konsequent im inneren Monolog geschrieben, zeigt dieser eindringliche Roman, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden. Isabel Bogdan, deren Roman »Der Pfau« ein großer Bestseller wurde, betritt mit diesem Buch neues Parkett.
Eine Frau läuft. Schnell wird klar, dass es nicht nur um ein gesünderes oder gar leichteres Leben geht. Durch ihre Augen und ihre mäandernden Gedanken erfährt der Leser nach und nach, warum das Laufen ein existenzielles Bedürfnis für sie ist. Wie wird man mit einem Verlust fertig? Welche Rolle spielen Freunde und Familie? Welche Rolle spielt die Zeit? Und der Beruf? Schritt für Schritt erobert sich die Erzählerin die Souveränität über ihr Leben zurück.
Isabel Bogdan beschreibt mit großem Einfühlungsvermögen und einem ganz anderen Ton den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt.
 Der Pfau
Der Pfau
Eine subtile Komödie in den schottischen Highlands – very british!
Ein charmant heruntergekommener Landsitz, auf dem ein Pfau verrücktspielt, eine Gruppe Banker beim Teambuilding, eine ambitionierte Psychologin, eine schwungvolle Haushälterin mit gebrochenem Arm, eine patente Köchin, Lord und Lady McIntosh, die alles unter einen Hut bringen müssen, dazu jede Menge Tiere – da weiß bald niemand mehr, was eigentlich passiert ist.
Isabel Bogdan, preisgekrönte Übersetzerin englischer Literatur, erzählt in ihrem ersten Roman mit britischem Understatement, pointenreich und überraschend von einem Wochenende, das ganz anders verläuft als geplant. Chefbankerin Liz und ihre vierköpfige Abteilung wollen in der ländlichen Abgeschiedenheit ihre Zusammenarbeit verbessern, werden aber durch das spartanische Ambiente und einen verrückt gewordenen Pfau aus dem Konzept gebracht. Die pragmatische Problemlösung durch Lord McIntosh setzt ein urkomisches Geschehen in Gang, das die Beteiligten an ihre Grenzen führt und sie einander näherbringt. Ein überraschender Wintereinbruch, eine Grippe und ein Kurzschluss tun ihr Übriges. Isabel Bogdan verbindet diese turbulente Handlung auf grandiose Weise mit liebevoller Figurenzeichnung.
So britisch-unterhaltsam ist in deutscher Sprache noch nicht erzählt worden!
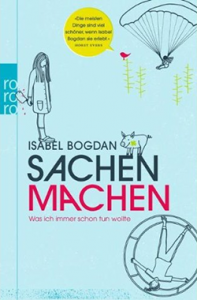 Sachen machen
Sachen machen
Wer macht denn sowas? Isabel Bogdan macht sowas. Sie blamiert sich im Rhönrad, wohnt der Schlachtung eines Schweins bei, staunt auf einer Esoterikmesse, spielt Ping-Pong mit Punks, besichtigt einen Darm, schlüpft in eine Fett-weg-Hose und schüttelt ihr Haar beim Heavy Metal-Festival in Wacken. Klingt nach einem großen Spaß? Ist es auch. 43 mal. Und wenn Sie das alles gelesen haben, wollen Sie plötzlich selbst Sachen machen. Wetten?
_________________________
Anthologiebeiträge
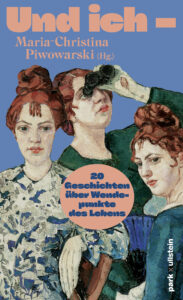 Brief an mich selbst. Am 05. Juli 2043 zu lesen in: Und ich – Hg. Maria-Christina Piwowarski. Mit literarischen Beiträgen von Gabriele von Arnim, Zsuzsa Bánk, Marica Bodrožić, Isabel Bogdan, Ann Cotten, Mareike Fallwickl, Julia Friese, Olga Grjasnowa, Claudia Hamm, Stefanie Jaksch, Rasha Khayat, Christine Koschmieder, Jarka Kubsova, Daria Kinga Majewski, Maria-Christina Piwowarski, Judith Poznan, Slata Roschal, Caca Savić, Clara Schaksmeier und Simone Scharbert
Brief an mich selbst. Am 05. Juli 2043 zu lesen in: Und ich – Hg. Maria-Christina Piwowarski. Mit literarischen Beiträgen von Gabriele von Arnim, Zsuzsa Bánk, Marica Bodrožić, Isabel Bogdan, Ann Cotten, Mareike Fallwickl, Julia Friese, Olga Grjasnowa, Claudia Hamm, Stefanie Jaksch, Rasha Khayat, Christine Koschmieder, Jarka Kubsova, Daria Kinga Majewski, Maria-Christina Piwowarski, Judith Poznan, Slata Roschal, Caca Savić, Clara Schaksmeier und Simone Scharbert
Unsere Leben verlaufen längst nicht so linear, wie wir sie uns und anderen oft erzählen. Spätestens in der Lebensmitte verlieren sich viele Menschen im Dickicht vergangener und zukünftiger Möglichkeiten, finden sich plötzlich in Sackgassen wieder, wo eigentlich Weggabelungen sein sollten. Insbesondere Frauen sehen sich mit gesellschaftlichen Hindernissen konfrontiert, wenn sie von vorgezeichneten Pfaden abweichen und einen Neuanfang wagen.
Die Anthologie „Und ich –“ erzählt von Momenten des Innehaltens, in denen alles auf den Kopf gestellt wird, um am Ende wieder geradegerückt zu werden. 20 Autorinnen schildern darin ganz unterschiedliche Lebenswege, die früher oder später jedoch alle in einem Wendepunkt mündeten, in einer alles verändernden Entscheidung. 20 Texte, die inspirieren und ermutigen, aber auch verstören und aufrütteln. Und die zeigen, dass es nie zu spät ist, dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben.
»Von geraden Straßen muss man irgendwann abbiegen, um glücklich dort anzukommen, wo man nicht hinwollte. Die Geschichten dieser wunderbaren Anthologie erzählen davon.« Gabriele von Arnim
Ullstein, 22,- €.
 Tokyo Blues in: Dinner for one. Vom Glück, in der Küche eine Verabredung mit sich selbst zu haben. Hg. Friederike Schilbach. Bloomsbury Taschenbuch, 9,99 €.
Tokyo Blues in: Dinner for one. Vom Glück, in der Küche eine Verabredung mit sich selbst zu haben. Hg. Friederike Schilbach. Bloomsbury Taschenbuch, 9,99 €.
 Brombeeren und Der Pfau (Romanauszug) in: Ziegel 13: Hamburger Jahrbuch für Literatur 2012/13, Hg. Jürgen Abel und Wolfgang Schömel. Dölling Und Galitz Verlag, 14,80 €.
Brombeeren und Der Pfau (Romanauszug) in: Ziegel 13: Hamburger Jahrbuch für Literatur 2012/13, Hg. Jürgen Abel und Wolfgang Schömel. Dölling Und Galitz Verlag, 14,80 €.
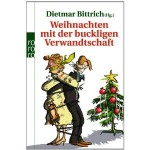 Klein Fawa in: Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft. Hg. Dietmar Bittrich. Rowohlt, 8,99 €.
Klein Fawa in: Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft. Hg. Dietmar Bittrich. Rowohlt, 8,99 €.
 Der Goethestein in: 63,75: Pfiffige Sichtweisen auf eine im Grunde ihres Herzens liebenswerte Stadt. 63 Menschen schreiben über 75 Orte, Objekte, Sachverhalte in Wiesbaden, Hg. Stijlroyal, 39,90 €. (DIN A3, 1,5 kg) (vergriffen)
Der Goethestein in: 63,75: Pfiffige Sichtweisen auf eine im Grunde ihres Herzens liebenswerte Stadt. 63 Menschen schreiben über 75 Orte, Objekte, Sachverhalte in Wiesbaden, Hg. Stijlroyal, 39,90 €. (DIN A3, 1,5 kg) (vergriffen)
_________________________
Artikelreihe „Mit anderen Worten“ – Über das Übersetzen
Diese Texte erschienen zwischen März und Juni 2010 unter der Überschrift „Mit anderen Worten“ im Titel-Magazin, inzwischen sind sie dort nicht mehr online. Dafür jetzt hier und im CulturMag.
1. Übersetzen ist eine darstellende Kunst
2. Was wir übersetzen: Wörter, Sätze, Texte
3. Was Bücher mit Übersetzern machen
4. Ja, sind wir denn unsichtbar?
5. Lotterleben
6. Das Böse™
Nur hier erschienen:
7. Traumjob (Ein anderer als Übersetzen.)
8. Warum ich keine englischen Bücher lese
9. Warum es so wichtig ist, die Übersetzer zu nennen
Früher kam es schon mal vor, dass sie Sonntags Nachmittags plötzlich vor der Tür stand. Wie sie denn hergekommen sei, fragten wir dann, denn das Autofahren hatten meine Eltern ihr bereits ein paar Jahre zuvor ausgeredet. „Autostop“, sagte strahlend,“da war so ein netter junger Mann, der hat mich bis vor die Tür gebracht.“ Da war sie um die siebzig. Unsere Freude über ihren Besuch hielt sich meist in Grenzen, denn sie war vor allem eins: anstrengend. Inzwischen glaube ich etwas anderes, ich glaube, sie war vor allem eins: unglaublich tapfer. Sie hatte es nicht leicht mit der Welt und vor allem mit sich selbst nicht, aber sie hat sich (und uns) so lange vorgebetet, dass man auf die Menschen zugehen muss und es viel Freude gibt im Leben, bis sie wahrscheinlich selbst nicht mehr wusste, ob sie nun optimistisch und lebensfroh war oder litt. Ihre Schwester, meine Oma, ist mit einer ähnlichen psychischen Disposition verbittert und böse geworden.
Tante Agnes hat Zeit ihres Lebens mit schweren Depressionen gekämpft und musste täglich Medikamente dagegen nehmen. Damit ging es ihr gut, bis sie wieder irgendeinem Heilfastenguru in die Finger fiel, der ihr versicherte, sie bräuchte das nicht, sie müsse nur dies und jenes beachten. Ein halbes Jahr später musste sie dann meist wieder für eine Weile in die Klinik, bis sie neu eingestellt war. Und nach ein paar Jahren alles wieder von vorne.
Inzwischen ist sie neunzig und lebt schon seit einigen Jahren auf der Pflegestation eines Altenheims. Körperlich ging das meiste noch, geistig eigentlich auch, nur die Psyche wollte gar nicht mehr, sie lag phasenweise nur noch im Bett, wimmerte, redete wirr, sah lauter kleine Krabbeltiere im Teppich, hatte Angst, jammerte, meine Eltern sollten öfter kommen, aber die Kinder, nein, „die Kinder sollen mich so nicht sehen“. Irgendwann änderte sich das wieder, es wurde immer besser, Isa, sagte sie zu meiner Mutter, Isa würde sie doch gerne mal wieder sehen.
Im Dezember entzündete sich eine Wunde an ihrer Hüfte und heilte gar nicht mehr, außerdem wurde Analkrebs diagnostiziert, sie sollte ins Krankenhaus und wehrte sich zunächst mit Händen und Füßen und großem Spektakel dagegen. Der Arzt sagte meinen Eltern, mit ein paar Wochen Krankenhaus dürfte es kaum getan sein, sie sollten sich besser auf mehrere Monate einrichten. Man schnitt ihr die Hüfte auf, nahm das alte künstliche Hüftgelenk heraus und setzte ein neues ein. Drei Wochen später kam sie aus dem Krankenhaus und spaziert seither munter mit ihrem Rollator durch die Gegend.
Gestern waren wir bei ihr. Sie strahlte. Sie freute sich ein Bein aus, uns zu sehen. Sie fragte, wie es mit dem Übersetzen läuft, und ob mein Mann Freude an seinem Beruf hat. Sie erinnerte sich, dass mein Schwiegervater aus Ostpreußen stammt, und hatte Fragen dazu. Erzählte Geschichten aus meiner Kindheit, erkundigte sich nach meinen Geschwistern und deren Kindern. Sie hat mehrfach richtig laut und vergnügt gelacht. Sie freute sich über ihre Zimmergenossin, die im Bett lag, lautstark Radio hörte, offensichtlich nicht ansprechbar war und nichts sagte, außer dass sie gelegentlich „Hallo!“ rief. „Ich freu mich“, sagte Tante Agnes, „die ist immer still, wenn ich Besuch habe, und wenn ich singe, dann summt sie mit. Ich singe auch immer Abends im Bett, dann summt sie auch, und dann wird sie irgendwann still, und dann werde ich auch ganz ruhig und kann gut schlafen.“ Und sie meinte, wenn wir das nächste Mal kämen, könnte sie bestimmt wieder noch besser laufen. „Andere bauen ja mit neunzig ab, ich blühe richtig auf.“

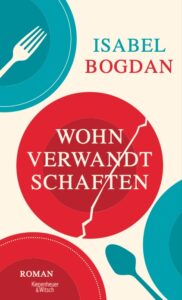



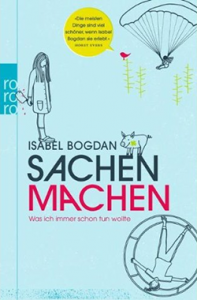
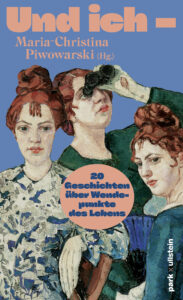
 Tokyo Blues in: Dinner for one. Vom Glück, in der Küche eine Verabredung mit sich selbst zu haben. Hg. Friederike Schilbach. Bloomsbury Taschenbuch, 9,99 €.
Tokyo Blues in: Dinner for one. Vom Glück, in der Küche eine Verabredung mit sich selbst zu haben. Hg. Friederike Schilbach. Bloomsbury Taschenbuch, 9,99 €.  Brombeeren und Der Pfau (Romanauszug) in: Ziegel 13: Hamburger Jahrbuch für Literatur 2012/13, Hg. Jürgen Abel und Wolfgang Schömel. Dölling Und Galitz Verlag, 14,80 €.
Brombeeren und Der Pfau (Romanauszug) in: Ziegel 13: Hamburger Jahrbuch für Literatur 2012/13, Hg. Jürgen Abel und Wolfgang Schömel. Dölling Und Galitz Verlag, 14,80 €.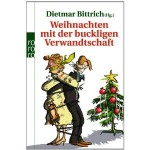 Klein Fawa in: Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft. Hg. Dietmar Bittrich. Rowohlt, 8,99 €.
Klein Fawa in: Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft. Hg. Dietmar Bittrich. Rowohlt, 8,99 €. Der Goethestein in: 63,75: Pfiffige Sichtweisen auf eine im Grunde ihres Herzens liebenswerte Stadt. 63 Menschen schreiben über 75 Orte, Objekte, Sachverhalte in Wiesbaden, Hg. Stijlroyal, 39,90 €. (DIN A3, 1,5 kg) (vergriffen)
Der Goethestein in: 63,75: Pfiffige Sichtweisen auf eine im Grunde ihres Herzens liebenswerte Stadt. 63 Menschen schreiben über 75 Orte, Objekte, Sachverhalte in Wiesbaden, Hg. Stijlroyal, 39,90 €. (DIN A3, 1,5 kg) (vergriffen)