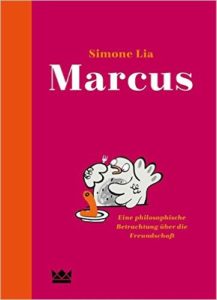Als Olinka Vištica und Dražen Grubišić sich getrennt haben, wussten sie nicht recht, wohin mit den gemeinsamen Erinnerungsstücken. Wegwerfen wollten sie sie ebensowenig wie behalten. Also haben sie tatsächlich ein Museum aufgemacht, das Museum der zerbrochenen Beziehungen in Zagreb, in dem sie solche Erinnerungsstücke aus aller Welt zusammentragen. Erinnerungen an Beziehungen, die nicht mehr bestehen. Weil nach mehreren Jahrzehnten die Liebe zu Ende war. Oder weil man sowieso nur einen Tag zusammen hatte und nie was draus geworden ist. Oder weil einer gestorben ist. Oder, oder, oder. Und zu diesem Museum gibt es nun ein Büchlein, in dem einige dieser Erinnerungsstücke vorgestellt werden. Jeder Gegenstand hat eine oder zwei Seiten, es gibt ein Foto und ein bisschen Text dazu. Manchmal nur einen Satz. Manchmal eine ganze Geschichte. Und alle, alle, alle brechen einem das Herz. Ich kann es gar nicht am Stück lesen, habe es auf dem Schreibtisch neben mir liegen und lese immer nur eine Seite. Einen Gegenstand. Vielleicht mal zwei. Und dann seufze ich tief und wende mich wieder meiner Übersetzung zu. Bis ich mir das nächste Mal das Herz brechen lasse. Von dem hässlichen Keramikfrosch zum Beispiel: das einzige Weihnachtsgeschenk, das ein Kind je von seiner Mutter bekommen hat, die Mutter hat die Familie nämlich verlassen, als das Kind drei wahr. Oder von der Asche eines geliebten Menschen, die in aller Welt verteilt wird. Oder von den Brustimplantanten, die nach dem Ende der Beziehung doch wieder rausgenommen wurden. Und dann muss ich auch mal kurz lachen, über den Liebesräucherduft, der auch auf dem Cover abgebildet ist, und bei dem nur steht: „Funktioniert nicht.“ Wenn der Herzbruch nicht mehr auszuhalten ist, klappe ich das Buch zu und kehre mit dem Anblick des Coverbilds zur Lakonie zurück. Ansonsten möchte man eigentlich aus jeder kleinen Geschichte einen Roman machen.
Als Olinka Vištica und Dražen Grubišić sich getrennt haben, wussten sie nicht recht, wohin mit den gemeinsamen Erinnerungsstücken. Wegwerfen wollten sie sie ebensowenig wie behalten. Also haben sie tatsächlich ein Museum aufgemacht, das Museum der zerbrochenen Beziehungen in Zagreb, in dem sie solche Erinnerungsstücke aus aller Welt zusammentragen. Erinnerungen an Beziehungen, die nicht mehr bestehen. Weil nach mehreren Jahrzehnten die Liebe zu Ende war. Oder weil man sowieso nur einen Tag zusammen hatte und nie was draus geworden ist. Oder weil einer gestorben ist. Oder, oder, oder. Und zu diesem Museum gibt es nun ein Büchlein, in dem einige dieser Erinnerungsstücke vorgestellt werden. Jeder Gegenstand hat eine oder zwei Seiten, es gibt ein Foto und ein bisschen Text dazu. Manchmal nur einen Satz. Manchmal eine ganze Geschichte. Und alle, alle, alle brechen einem das Herz. Ich kann es gar nicht am Stück lesen, habe es auf dem Schreibtisch neben mir liegen und lese immer nur eine Seite. Einen Gegenstand. Vielleicht mal zwei. Und dann seufze ich tief und wende mich wieder meiner Übersetzung zu. Bis ich mir das nächste Mal das Herz brechen lasse. Von dem hässlichen Keramikfrosch zum Beispiel: das einzige Weihnachtsgeschenk, das ein Kind je von seiner Mutter bekommen hat, die Mutter hat die Familie nämlich verlassen, als das Kind drei wahr. Oder von der Asche eines geliebten Menschen, die in aller Welt verteilt wird. Oder von den Brustimplantanten, die nach dem Ende der Beziehung doch wieder rausgenommen wurden. Und dann muss ich auch mal kurz lachen, über den Liebesräucherduft, der auch auf dem Cover abgebildet ist, und bei dem nur steht: „Funktioniert nicht.“ Wenn der Herzbruch nicht mehr auszuhalten ist, klappe ich das Buch zu und kehre mit dem Anblick des Coverbilds zur Lakonie zurück. Ansonsten möchte man eigentlich aus jeder kleinen Geschichte einen Roman machen.
„Die Sache währte 300 Tage zu lang. Er gab mir sein Handy, damit ich ihn nicht mehr anrufen konnte.“
Olinka Vištica und Dražen Grubišić (Marcus Gärtner): Das Museum der zerbrochenen Beziehungen. Rowohlt, 15,00 €
 JA! Jajaja! Endlich mal wieder bis mitten in der Nacht noch auslesen müssen und dann mit Herzklopfen im Bett liegen. Was für ein Spannungsaufbau! Dabei fängt es so leise und zart an mit der Geschichte eines Jungen, Hans, der seine Eltern verliert und ins Internat kommt. Nach dem Abitur verschafft seine Tante Alex ihm einen Studienplatz in Cambridge, wo sie Professorin ist. Im Gegenzug soll er in einem Club etwas für sie herausfinden, weiß aber nicht mal, was eigentlich. Und in so einen Club in Cambridge spaziert man auch nicht einfach so rein, sondern da muss man die richtigen Leute kennen und eingeladen werden und so weiter. Clubs für die reichen Söhne reicher Väter, Frauen sind bestenfalls schmückendes Beiwerk, Clubs fürs Leben, „man kennt sich“ und schanzt einander die wichtigen Posten in Wirtschaft und Politik zu. Alles höchst elitär und männerbündisch. Einige dieser Clubs sind offiziell, es gibt eigene Clubblazer und -fliegen, die man aber nur unter bestimmten Bedingungen tragen darf, und was auf jeden Fall hilft, ist, außerdem im Boxclub zu sein. Glücklicherweise ist Hans sowieso Boxer, und außerdem hat er Charlotte an seiner Seite, die aus den entsprechenden Kreisen stammt und ebenfalls ein Interesse daran hat, dass er etwas herausfindet. Auch sie sagt ihm zunächst nicht, worum genau es geht, verhilft ihm aber zum Eintritt in den Club. Und dann gibt es noch einen geheimen Club, dessen Mitglieder auf der Rückseite ihrer Fliegen einen Schmetterling eingestickt haben, aber das weiß niemand. Und spätestens beim Aufnahmeritual für diesen speziellen Club wird es dann richtig ekelhaft. Und eben so, dass man es kaum aushält, weil man nicht möchte, dass das passiert, was passiert – dabei ist nichts davon besonders explizit geschildert, aber man fühlt sich so nah dran, dass man am liebsten eingreifen möchte. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Figuren so plastisch sind, es gibt wechselnde Perspektiven, hauptsächlich die von Hans, aber auch alle anderen kommen zwischendurch immer mal wieder als Ich-Erzähler zu Wort, manche mehr, manche weniger. Dadurch lässt einen gar nichts kalt, keine Figur ist einem egal. Man mag sie, man verachtet sie, man möchte sie in den Arm nehmen oder schütteln und manchmal beides. Großartig ist das, ich bin wirklich begeistert.
JA! Jajaja! Endlich mal wieder bis mitten in der Nacht noch auslesen müssen und dann mit Herzklopfen im Bett liegen. Was für ein Spannungsaufbau! Dabei fängt es so leise und zart an mit der Geschichte eines Jungen, Hans, der seine Eltern verliert und ins Internat kommt. Nach dem Abitur verschafft seine Tante Alex ihm einen Studienplatz in Cambridge, wo sie Professorin ist. Im Gegenzug soll er in einem Club etwas für sie herausfinden, weiß aber nicht mal, was eigentlich. Und in so einen Club in Cambridge spaziert man auch nicht einfach so rein, sondern da muss man die richtigen Leute kennen und eingeladen werden und so weiter. Clubs für die reichen Söhne reicher Väter, Frauen sind bestenfalls schmückendes Beiwerk, Clubs fürs Leben, „man kennt sich“ und schanzt einander die wichtigen Posten in Wirtschaft und Politik zu. Alles höchst elitär und männerbündisch. Einige dieser Clubs sind offiziell, es gibt eigene Clubblazer und -fliegen, die man aber nur unter bestimmten Bedingungen tragen darf, und was auf jeden Fall hilft, ist, außerdem im Boxclub zu sein. Glücklicherweise ist Hans sowieso Boxer, und außerdem hat er Charlotte an seiner Seite, die aus den entsprechenden Kreisen stammt und ebenfalls ein Interesse daran hat, dass er etwas herausfindet. Auch sie sagt ihm zunächst nicht, worum genau es geht, verhilft ihm aber zum Eintritt in den Club. Und dann gibt es noch einen geheimen Club, dessen Mitglieder auf der Rückseite ihrer Fliegen einen Schmetterling eingestickt haben, aber das weiß niemand. Und spätestens beim Aufnahmeritual für diesen speziellen Club wird es dann richtig ekelhaft. Und eben so, dass man es kaum aushält, weil man nicht möchte, dass das passiert, was passiert – dabei ist nichts davon besonders explizit geschildert, aber man fühlt sich so nah dran, dass man am liebsten eingreifen möchte. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Figuren so plastisch sind, es gibt wechselnde Perspektiven, hauptsächlich die von Hans, aber auch alle anderen kommen zwischendurch immer mal wieder als Ich-Erzähler zu Wort, manche mehr, manche weniger. Dadurch lässt einen gar nichts kalt, keine Figur ist einem egal. Man mag sie, man verachtet sie, man möchte sie in den Arm nehmen oder schütteln und manchmal beides. Großartig ist das, ich bin wirklich begeistert.
UND! Es ist in gestreifte Seide in den Clubfarben gebunden! Und hat ein Lesebändchen. Ausdrückliche Leseempfehlung auch für Männer, die sonst nicht viel lesen.
Takis Würger: Der Club. Kein und Aber, 240 Seiten, 22,- €. Auch als Hörbuch und E-Book.
Hier ein Bericht von Takis Würger über seine eigene Zeit in Cambridge.
Und hier ein Gespräch im Deutschlandradio.
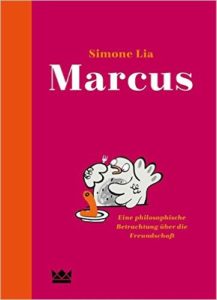 Marcus ist ein Wurm. Seine Lieblingsfarbe ist braun, weil Matsch braun ist und er Matsch richtig, richtig, richtig gern mag. Durch einen ziemlich blöden Zufall landet Marcus auf dem Teller von Laurence. Laurence ist ein Huhn. Beziehungsweise Laurence sieht genau aus wie ein Huhn, aber eigentlich, tief innen drin, ist er ein Flamingo. Das glaubt ihm nur niemand. Jedenfalls sieht er also aus wie ein Huhn, und Marcus liegt auf seinem Teller und ist ein Wurm, was zweifellos eine ziemlich unschöne Situation ist. Er sagt schnell und vor Schreck ganz laut „ICH HEISSE MARCUS. MEINE LIEBLINGSFARBE IST BRAUN UND MEIN HOBBY LÖCHER IN DIE ERDE GRABEN“ und so weiter, und dann verwickelt er Laurence in ein Gespräch. Der erklärt ihm die Sache mit dem Flamingo, und dass er deswegen unbedingt nach Afrika möchte, zu den anderen Flamingos, aber den Weg nicht kennt. Marcus ist super im Wegefinden, oder behauptet das jedenfalls vorsichtshalber, also machen sie sich gemeinsam auf den Weg nach Afrika, zu den anderen Flamingos, und erleben dabei aufregende Abenteuer. Und das ist natürlich alles ganz zauberhaft und herzerwärmend und auch ganz schön spannend, sie begegnen nämlich auch ziemlich bösen Tieren und bringen ihnen das Beatboxen bei, um nicht beide zusammen im Eintopf zu landen. Hinterher haben natürlich alle etwas gelernt und etwas erlebt und ganz wunderbare neue Freundschaften geschlossen und neues Selbstbewusstsein gewonnen. Und ganz wundervoll illustriert ist es auch. Und jetzt alle: Hach! So schön.
Marcus ist ein Wurm. Seine Lieblingsfarbe ist braun, weil Matsch braun ist und er Matsch richtig, richtig, richtig gern mag. Durch einen ziemlich blöden Zufall landet Marcus auf dem Teller von Laurence. Laurence ist ein Huhn. Beziehungsweise Laurence sieht genau aus wie ein Huhn, aber eigentlich, tief innen drin, ist er ein Flamingo. Das glaubt ihm nur niemand. Jedenfalls sieht er also aus wie ein Huhn, und Marcus liegt auf seinem Teller und ist ein Wurm, was zweifellos eine ziemlich unschöne Situation ist. Er sagt schnell und vor Schreck ganz laut „ICH HEISSE MARCUS. MEINE LIEBLINGSFARBE IST BRAUN UND MEIN HOBBY LÖCHER IN DIE ERDE GRABEN“ und so weiter, und dann verwickelt er Laurence in ein Gespräch. Der erklärt ihm die Sache mit dem Flamingo, und dass er deswegen unbedingt nach Afrika möchte, zu den anderen Flamingos, aber den Weg nicht kennt. Marcus ist super im Wegefinden, oder behauptet das jedenfalls vorsichtshalber, also machen sie sich gemeinsam auf den Weg nach Afrika, zu den anderen Flamingos, und erleben dabei aufregende Abenteuer. Und das ist natürlich alles ganz zauberhaft und herzerwärmend und auch ganz schön spannend, sie begegnen nämlich auch ziemlich bösen Tieren und bringen ihnen das Beatboxen bei, um nicht beide zusammen im Eintopf zu landen. Hinterher haben natürlich alle etwas gelernt und etwas erlebt und ganz wunderbare neue Freundschaften geschlossen und neues Selbstbewusstsein gewonnen. Und ganz wundervoll illustriert ist es auch. Und jetzt alle: Hach! So schön.

Simone Lia (Ingo Herzke): Marcus. Königskinder, 15,99 €
 Aufstehen und das Fenster öffnen: Das tut man, wenn derjenige gestorben ist, an dessen Bett man sitzt. Man öffnet das Fenster, damit seine Seele hinauskann. Fred ist eigentlich gar nicht der Typ für sowas, er ist ein eher trockener, um nicht zu sagen: langweiliger Beamter, außerdem alleinerziehender Vater des 13jährigen Phil. Und jetzt hat Fred eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht und begleitet als erste Karla, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Sie kommt eigentlich gut selbst zurecht und möchte sich bestimmt nicht betüddeln lassen, dafür ist sie viel zu stark und eigensinnig. Was man von Fred nicht behaupten kann. Aber natürlich braucht Karla trotzdem zunehmend Hilfe. Fred versemmelt es zunächst gründlich, wegen der Sache mit „gut gemeint“ und „gut gemacht“; Phil und Karlas Hausmeisternachbar sorgen schließlich dafür, dass er noch eine zweite Chance bekommt.
Aufstehen und das Fenster öffnen: Das tut man, wenn derjenige gestorben ist, an dessen Bett man sitzt. Man öffnet das Fenster, damit seine Seele hinauskann. Fred ist eigentlich gar nicht der Typ für sowas, er ist ein eher trockener, um nicht zu sagen: langweiliger Beamter, außerdem alleinerziehender Vater des 13jährigen Phil. Und jetzt hat Fred eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht und begleitet als erste Karla, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Sie kommt eigentlich gut selbst zurecht und möchte sich bestimmt nicht betüddeln lassen, dafür ist sie viel zu stark und eigensinnig. Was man von Fred nicht behaupten kann. Aber natürlich braucht Karla trotzdem zunehmend Hilfe. Fred versemmelt es zunächst gründlich, wegen der Sache mit „gut gemeint“ und „gut gemacht“; Phil und Karlas Hausmeisternachbar sorgen schließlich dafür, dass er noch eine zweite Chance bekommt.
Das ist die Geschichte, und sie endet natürlich, wie eine Sterbebegleitung enden muss. Was allerdings nicht heißt, dass das ein trauriges Buch wäre, denn hey: Das ist Susann Pásztor, und deswegen kann man ruhig ein Buch über das Sterben lesen, auch wenn man in der glücklichen Situation ist, dass man sich selbst noch gar nicht mit dem Thema beschäftigen musste. Sie geht auf die bestmögliche Weise pragmatisch mit diesem großen Thema um und schreibt auf der Grundlage eines wunderbaren Humors; die Sorte, die eine Lebenseinstellung ist, nicht die, die Witze macht. Das zeigt sich zum Beispiel in einem feinen Gespür für skurrile Situationen, in denen sie ihre Figuren aber niemals bloßstellt oder sich über sie lustig macht. Es gibt da zum Beispiel eine Supervisionsgruppe für Sterbebegleiter, in der Fred und seine Kollegen sich über ihre Erlebnisse austauschen und einander Rat und Stütze sind. Es darf aber immer nur derjenige sprechen, der den Redestein hat. Natürlich ist das grotesk, und es wäre an der Stelle sehr einfach gewesen, es auf die Spitze zu treiben und die Figuren zu verspotten. Ebenso wie es anderswo einfach gewesen wäre, auf die Tränendrüse zu drücken, aber das tut sie alles nicht. Man liest dieses Buch und weiß, dass die Autorin ein großes, warmes Herz hat. Für alle. Und eine zupackende Seele. Und dann möchte man ein Glas Wein mit ihr trinken oder fünf.
Susann Pásztor: Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. KiWi, 20,00 €
***
Hier ein Interview, das ich zum Erscheinen ihres letzten Buches mit Susann Pasztor geführt habe.
Und so fand ich die beiden Vorgängerbücher:
Ein fabelhafter Lügner
Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts
 In der ZEIT gibt es seit ich-weiß-nicht-wie-lange die Rubrik Liebesbrief, in der die unterschiedlichsten Leute Liebesbriefe schreiben, an irgendjemanden ihrer Wahl, und das ist oft sehr, sehr schön. Einmal durfte ich auch, ich habe an Katja Lange-Müller geschrieben. Einige dieser Liebesbriefe sind jetzt gesammelt als Buch bei Arche erschienen, in einem ganz besonders hübschen Bändchen. Und das Dollste ist: Beim Lesen fängt man plötzlich an, sich für die erstaunlichsten Leute zu interessieren. Oder man weint ein bisschen. Oder lächelt, das zum Glück öfter. Ist bald Valentinstag? Das wäre ein hübsches Geschenk.
In der ZEIT gibt es seit ich-weiß-nicht-wie-lange die Rubrik Liebesbrief, in der die unterschiedlichsten Leute Liebesbriefe schreiben, an irgendjemanden ihrer Wahl, und das ist oft sehr, sehr schön. Einmal durfte ich auch, ich habe an Katja Lange-Müller geschrieben. Einige dieser Liebesbriefe sind jetzt gesammelt als Buch bei Arche erschienen, in einem ganz besonders hübschen Bändchen. Und das Dollste ist: Beim Lesen fängt man plötzlich an, sich für die erstaunlichsten Leute zu interessieren. Oder man weint ein bisschen. Oder lächelt, das zum Glück öfter. Ist bald Valentinstag? Das wäre ein hübsches Geschenk.
 Als Olinka Vištica und Dražen Grubišić sich getrennt haben, wussten sie nicht recht, wohin mit den gemeinsamen Erinnerungsstücken. Wegwerfen wollten sie sie ebensowenig wie behalten. Also haben sie tatsächlich ein Museum aufgemacht, das Museum der zerbrochenen Beziehungen in Zagreb, in dem sie solche Erinnerungsstücke aus aller Welt zusammentragen. Erinnerungen an Beziehungen, die nicht mehr bestehen. Weil nach mehreren Jahrzehnten die Liebe zu Ende war. Oder weil man sowieso nur einen Tag zusammen hatte und nie was draus geworden ist. Oder weil einer gestorben ist. Oder, oder, oder. Und zu diesem Museum gibt es nun ein Büchlein, in dem einige dieser Erinnerungsstücke vorgestellt werden. Jeder Gegenstand hat eine oder zwei Seiten, es gibt ein Foto und ein bisschen Text dazu. Manchmal nur einen Satz. Manchmal eine ganze Geschichte. Und alle, alle, alle brechen einem das Herz. Ich kann es gar nicht am Stück lesen, habe es auf dem Schreibtisch neben mir liegen und lese immer nur eine Seite. Einen Gegenstand. Vielleicht mal zwei. Und dann seufze ich tief und wende mich wieder meiner Übersetzung zu. Bis ich mir das nächste Mal das Herz brechen lasse. Von dem hässlichen Keramikfrosch zum Beispiel: das einzige Weihnachtsgeschenk, das ein Kind je von seiner Mutter bekommen hat, die Mutter hat die Familie nämlich verlassen, als das Kind drei wahr. Oder von der Asche eines geliebten Menschen, die in aller Welt verteilt wird. Oder von den Brustimplantanten, die nach dem Ende der Beziehung doch wieder rausgenommen wurden. Und dann muss ich auch mal kurz lachen, über den Liebesräucherduft, der auch auf dem Cover abgebildet ist, und bei dem nur steht: „Funktioniert nicht.“ Wenn der Herzbruch nicht mehr auszuhalten ist, klappe ich das Buch zu und kehre mit dem Anblick des Coverbilds zur Lakonie zurück. Ansonsten möchte man eigentlich aus jeder kleinen Geschichte einen Roman machen.
Als Olinka Vištica und Dražen Grubišić sich getrennt haben, wussten sie nicht recht, wohin mit den gemeinsamen Erinnerungsstücken. Wegwerfen wollten sie sie ebensowenig wie behalten. Also haben sie tatsächlich ein Museum aufgemacht, das Museum der zerbrochenen Beziehungen in Zagreb, in dem sie solche Erinnerungsstücke aus aller Welt zusammentragen. Erinnerungen an Beziehungen, die nicht mehr bestehen. Weil nach mehreren Jahrzehnten die Liebe zu Ende war. Oder weil man sowieso nur einen Tag zusammen hatte und nie was draus geworden ist. Oder weil einer gestorben ist. Oder, oder, oder. Und zu diesem Museum gibt es nun ein Büchlein, in dem einige dieser Erinnerungsstücke vorgestellt werden. Jeder Gegenstand hat eine oder zwei Seiten, es gibt ein Foto und ein bisschen Text dazu. Manchmal nur einen Satz. Manchmal eine ganze Geschichte. Und alle, alle, alle brechen einem das Herz. Ich kann es gar nicht am Stück lesen, habe es auf dem Schreibtisch neben mir liegen und lese immer nur eine Seite. Einen Gegenstand. Vielleicht mal zwei. Und dann seufze ich tief und wende mich wieder meiner Übersetzung zu. Bis ich mir das nächste Mal das Herz brechen lasse. Von dem hässlichen Keramikfrosch zum Beispiel: das einzige Weihnachtsgeschenk, das ein Kind je von seiner Mutter bekommen hat, die Mutter hat die Familie nämlich verlassen, als das Kind drei wahr. Oder von der Asche eines geliebten Menschen, die in aller Welt verteilt wird. Oder von den Brustimplantanten, die nach dem Ende der Beziehung doch wieder rausgenommen wurden. Und dann muss ich auch mal kurz lachen, über den Liebesräucherduft, der auch auf dem Cover abgebildet ist, und bei dem nur steht: „Funktioniert nicht.“ Wenn der Herzbruch nicht mehr auszuhalten ist, klappe ich das Buch zu und kehre mit dem Anblick des Coverbilds zur Lakonie zurück. Ansonsten möchte man eigentlich aus jeder kleinen Geschichte einen Roman machen.