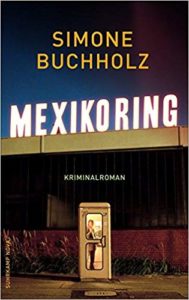Ich setze mich auf eine Holzbank und schaue auf das Gestrüpp neben der Bank. Es gefällt mir sehr gut, weil es nichts als sein eigenes Ausharren ausdrückt. Ich möchte so sein wie dieses Gestrüpp. Es ist täglich da, es leistet Widerstand, indem es nicht verschwindet, es klagt nicht, es spricht nicht, es braucht nichts, es ist praktisch unüberwindbar. Ich empfinde Lust, meine Jacke auszuziehen und sie in hohem Bogen in das Gestrüpp zu werfen. Auf diese Weise hätte ich vielleicht Anteil an der Beharrungskraft des Gestrüpps. Schon das Wort Gestrüpp beeindruckt mich. Es ist vielleicht das Wort für die Gesamtmerkwürdigkeit allen Lebens, nach dem ich schon so lange suche. Das Gestrüpp drückt meinen Schmerz aus, ohne mich anzustrengen. (Ein Regenschirm für diesen Tag, S. 93/94)
Wilhelm Genazino ist gestorben. Sehr traurig. Er war erst 75 Jahre alt. Gerade habe ich das Wort „Gestrüpp“ in meine Übersetzung geschrieben.
(Hier ist ein schöner Nachruf von Jo Lendle.)
- „Dass es jetzt überall Rollstuhlrampen gibt, heißt ja nicht, dass niemand mehr Treppen benutzen darf.“ Kristof Magnusson auf HR2 über Literatur in einfacher Sprache.
- Die besten Outfits für Leute, die zu Hause arbeiten.
- Katja Lange-Müller und Teresia Enzensberger im Gespräch über Literatur von Frauen im klassischen Kanon im Deutschlandfunk.
- Gleiches Thema, aber diesmal statistisch untermauert: Nina George und einige andere Frauen haben Frauen in der Literaturkritik gezählt. Die Uni Rostock hat die wenig überraschenden Ergebnisse jetzt ausgewertet. Spoiler: „Nur ein Drittel der Rezensionen befasste sich mit Büchern von Autorinnen. In zwei Dritteln der Beiträge ging es um die Werke von Autoren.“
- Alex Capus über das Schreiben:
Ich bin keiner dieser Schriftsteller, die gefühlt immer zu wenig Zeit haben, ihre vielen Ideen zu Papier zu bringen. Ich schöpfe nicht aus dem Vollen. Ich lebe seit Jahrzehnten mit der Angst, dass mir nichts mehr einfällt, dass ich eines Tages sagen muss: Das wars!
Ehrlich, mich beruhigt sowas. Ich lebe nicht mal nur mit der Angst, sondern sogar mit der Überzeugung, dass mir nichts einfällt. Deswegen habe ich nie geschrieben. (Bis mir halt doch was begegnet ist. Aber doch nicht eingefallen!)
- Mein Verleger Helge Malchow geht in Ruhestand und zieht vorher nochmal Bilanz. Wenn man sich den Verlag Kiepenheuer und Witsch so anguckt, möchte man wohl sagen: Alles richtig gemacht. Thank you for the music, Herr Malchow.
- Und zum Schluss noch ein Interview mit Helge Malchow und seiner Nachfolgerin Kerstin Gleba. Sie ist schon seit Ewigkeiten im Verlag und rückt ganz organisch nach. Ich ich möchte sagen: Schon wieder alles richtig gemacht, sie ist toll.
Einer hat sich von seiner Liebsten getrennt. Nicht, weil da keine Liebe mehr wäre oder zu wenig, oder weil es zwischen ihnen nicht mehr funktionieren würde, sondern weil er katholischer Priester ist und es nicht mehr aushält. Liebe deinen Nächsten, sagt die Kirche, aber wenn du bei mir arbeiten möchtest, gefälligst nur platonisch. Und was, Kirche, ist eigentlich mit dem Thema Verzeihen? Ihr könnt einem Menschen nicht verzeihen, dass er liebt? Es zerreißt ihn, und seine Liebste mit.
Ein Sohn zieht zu Hause aus, und anderswo eine Tochter. Loslassen mit Freude und Sorge und Wehmut und dem Wissen, dass es richtig ist und nur ein bisschen Loslassen und nicht komplett.
Einer musste seinen Hund einschläfern lassen. So ein Baum von einem Mann, er ist innen drin ganz weich, glaube ich, deswegen hat er außen rum so eine Schutzschicht aus Ironie und Bart und Gebrumm, aber manchmal, da macht er die Tür auf und man kann ein bisschen reingucken, und dann ist es da drin warm und schön. Er schreibt: „Das ist der letzte Weg, den ich mit meinem Kumpel gehe“, und es bricht mir das Herz. Er war sein Kumpel, dieser Hund, ich kannte den Hund nicht, aber wenn er über ihn sprach, dann hat man das gemerkt. Am nächsten Morgen frage ich, wie es ihm geht. „Beschossen wär noch geprahlt“, schreibt er, und dann, dass das „beschissen“ heißen sollte, und ich sage: „Ich versteh dich auch beschossen.“
Paare trennen sich, meistens ist das gut so, aber nie geht es ohne Schmerz. Manche hatten schon lange losgelassen, es sich aber nie eingestanden. Manchmal gibt es ein Gezerr um die Kinder, dabei können die am wenigsten dafür, alle sind überfordert. Manchmal können Menschen, die sich einmal geliebt haben, nicht mehr miteinander reden. Vielleicht würde es besser gehen, wenn sie losließen. Verzeihen hat mit Loslassen zu tun.
Bei einer wurde eingebrochen. Ihr Schmuck wurde geklaut – Familienerbstücke, Erinnerungsstücke an besondere Momente im Leben, Urlaubsmitbringsel. Alles nicht viel Geld wert, aber es hingen Erinnerungen dran. Man soll sein Herz nicht an Dinge hängen, aber das tut man, man gewinnt Gegenstände lieb, sogar dann, wenn man sie gar nicht mehr trägt, wenn man sie nur einmal im Jahr beim Aufräumen findet und jedes Mal denkt, „ach, das hast du damals in Kroatien auf dem Markt gekauft“. Es ist nicht der materielle Wert.
Eine muss sich von ihrem Kinderwunsch verabschieden. Ihr Mann auch, aber für Männer ist es anders, als Frau ist die Zeit irgendwann vorbei. Der Abschied kommt schleichend, über Jahre, und das sind Jahre der monatlichen Hoffnung und monatlichen Enttäuschung, der zermürbenden Behandlungen und der noch schlimmeren Bemerkungen von Freunden, Kolleginnen, Familie. Mit der Zeit werden die Kommentare weniger, und den Schmerz wickelt man vorsichtig in weiche Tücher, damit er nicht mehr so scharfkantig ist, aber weggehen wird er nicht, und sein Gewicht behält er. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Zwei haben Krebs. Eine ist alt und der Krebs vielleicht in den Griff zu kriegen, das ist noch nicht ganz klar. Eine ist jung und der Krebs der Brutalste, den man haben kann. Vernichtend. Ich kann mir dieses Loslassen nicht mal im Ansatz vorstellen. Das Leben loslassen. Die geliebte Person loslassen, endgültig und für immer, einfach nur so, weil Krebs ein Arschloch ist. Wie soll das gehen.
Wir wissen, dass alles, was kommt, auch wieder geht.
Warum tut es dann immer wieder und immer mehr weh?
(Gundermann)
Immer wieder überraschend, was man beim Übersetzen so lernt: Eine Hand of Glory ist die abgehackte Hand eines Menschen (genauer gesagt: eines Erhängten). Wenn man sich als Einbrecher Zutritt zu einem Haus verschafft hat, kann man, wenn alle anderen im Haus schlafen, eine Kerze in diese Hand stecken (ich erspare Euch die Zutaten, aus denen die Kerze herzustellen ist), und mit folgender Beschwörung dafür sorgen, dass alle im Haus sehr fest schlafen und nur der Einbrecher hübsch wachbleibt:
Let those who rest more deeply sleep,
Let those awake their vigil keep.
Oh hand of Glory, shed thy light,
Direct us to our spoil tonight.
Alsdann ruft der Einbrecher in meiner Geschichte mithilfe der leuchtenden Hand seine Bande zusammen, die draußen wartet:
Flash out thy light, oh skeleton hand,
And guide the feet of our trusty band.
Ich bin mit meinen Versuchen bis hier gekommen:
Lass die, die schlafen, tiefer ruhn,
und die, die wach sind, hellwach sein.
Hand des Lichts, wirf deinen Schein
Auf unsre reiche Beute nun.
Wirf dein Licht, du Leichenhand
Und zeig den Weg der Räuberband’.
… aber noch gar nicht glücklich. Na los, Ihr seid doch besser als ich.
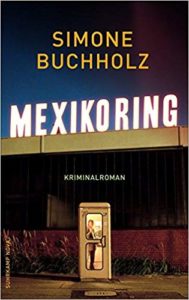 Nicht zu fassen, ich habe hier erst über einen einzigen Roman von Simone Buchholz geschrieben? Dabei habe ich seitdem noch Eisnattern, Blaue Nacht und Beton Rouge gelesen. Und jetzt Mexikoring. Anders gesagt: Ich bin Fan.
Nicht zu fassen, ich habe hier erst über einen einzigen Roman von Simone Buchholz geschrieben? Dabei habe ich seitdem noch Eisnattern, Blaue Nacht und Beton Rouge gelesen. Und jetzt Mexikoring. Anders gesagt: Ich bin Fan.
All diese Romane gehören zur selben Reihe um die ermittelnde Staatsanwältin Chastity Riley. (Jaja, komischer Name erstmal, erklärt sich aber.) Die Romane befassen sich inhaltlich immer mit unterschiedlichen Themen, diesmal mit Clankriminalität, und sind immer sehr sauber recherchiert. Die Krimihandlung ist mir beim Lesen allerdings gar nicht so wichtig, das Großartige an dieser Reihe sind nämlich zum einen die Figuren, ihre Entwicklung und ihr Zusammenspiel, und zum anderen die Sprache. Der Sound.
Chastity Riley ist eine beschädigte Seele, sie raucht und trinkt unfassbare Mengen, sie ist herzzerreißend einsam und bindungsunfähig. Aber über all dem Scheiß und dem Elend, mit dem sie immer wieder konfrontiert ist, ist sie nie hart geworden, sie hat ein sehr fein justiertes Gerechtigkeitsempfinden und ein gutes Gespür für die emotionalen Nöte ihrer Freunde und Kollegen. Nur mit ihren eigenen findet sie keinen rechten Umgang. Umso besser ist sie im Kreis dieser Freunde und Kollegen aufgehoben – allesamt ebenfalls beschädigte Seelen, die aufeinander aufpassen, so gut sie es eben können. Und die versuchen, Dinge richtig zu machen und in Ordnung zu bringen, auch wenn sie selbst dabei neue Narben davontragen. Im Laufe der Serie verschieben sich die Freundschafen und verändern sich, manche gehen weg, andere kommen zurück. Alles hat seine Zeit, und die darf es auch haben.
Und die Gefühle dürfen dabei ruhig groß sein, und zwar deswegen, weil sie nie künstlich groß gemacht werden und weil sie nie mit einem Klischee beschrieben werden, nie mit einem Satz, den man schon kennt. Es steht nie das erwartbare Adjektiv vor einem Substantiv. Ganz kleines Beispiel: „Sein Blick ging mir …“ na, wohin ging er? Bis ins Mark? Durch Mark und Bein? Durch und durch? Nichts davon. Sondern: „Sein Blick ging mir bis in die letzte Ecke.“ Sagt inhaltlich das gleiche, ist nur eine winzige Verschiebung, aber der Satz erwischt einen plötzlich ganz neu, man versteht ihn auf einmal wieder, wie man ihn bei „Sein Blick ging mir durch und durch“ gar nicht mehr verstehen würde, weil man das schon zu oft gelesen hat. Oder hier: „In der Kneipe liegen ein paar letzte Sonnenstrahlen herum.“ Macht gleich ein etwas anderes Bild als „ein paar letzte Sonnenstrahlen fallen in die Kneipe“.
Oder sie haut solche Lebensweisheiten raus wie „Dosenbier kannst du nur dann mit Würde trinken, wenn du weißt, wie der Regen im Rinnstein schmeckt.“ Ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, Quatsch, aber in dem Moment passt es einfach und muss so. Und dann kommt irgendwann auch noch diese hinreißende Kussszene, und man möchte sofort auch geküsst werden. Dringend. Und zwar genauso dringend.
Simone Buchholz: Mexikoring. 248 Seiten. Suhrkamp, 14,99 €.
E-Book 12,99 €
(Die Links gehen zur Buchhandlung Cohen und Dobernigg. Keine Werbekooperation, nur ein Vorschlag. Gibts auch in jeder anderen Buchhandlung.)