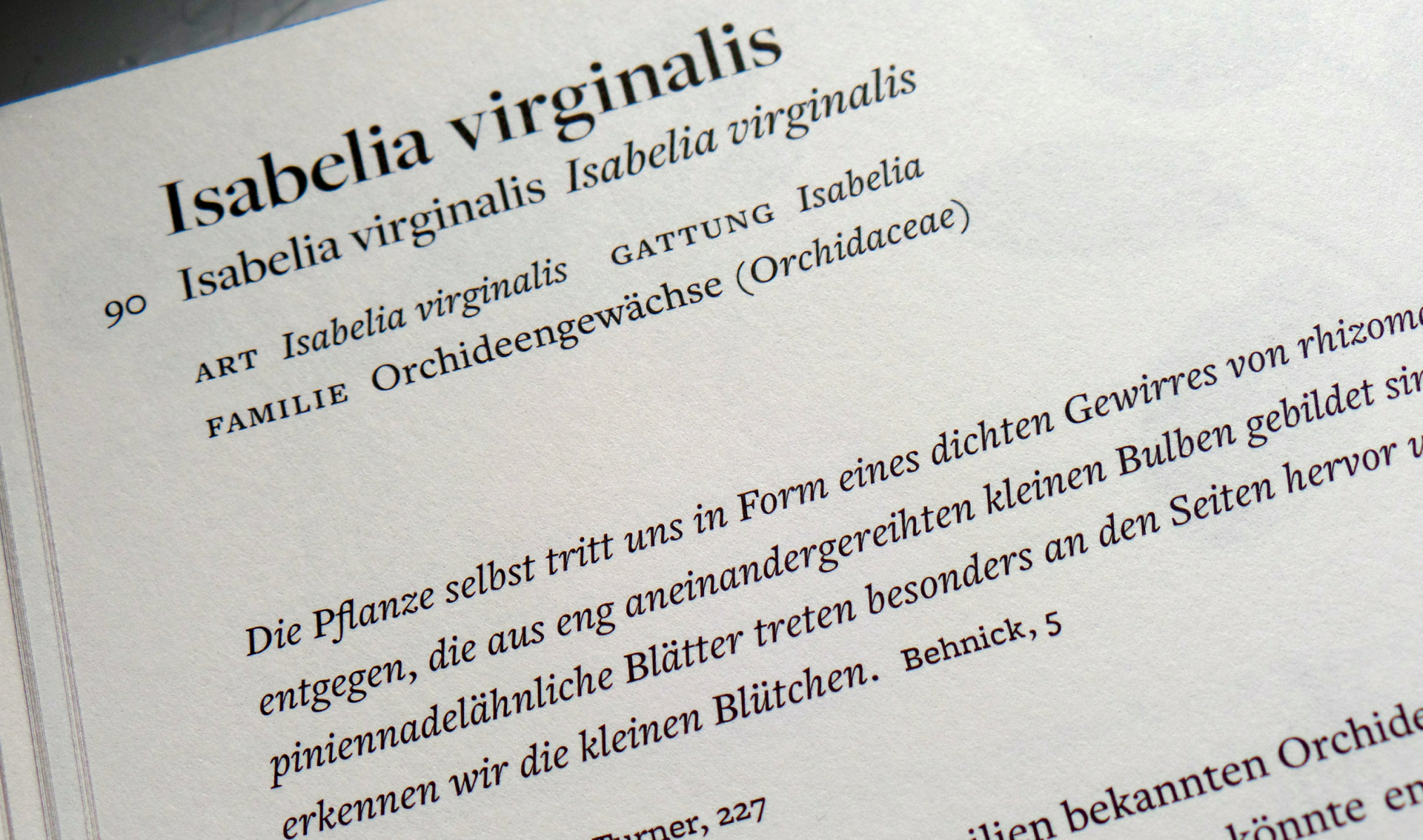Das ist ja ein Ding. Liegt da plötzlich dieses Buch im Briefkasten, und ich habe keine Ahnung, wer mir das hat schicken lassen. Es kommt direkt vom Verlag Matthes & Seitz, bzw. von der Auslieferung. Kein Lieferschein dabei, kein nichts. Aber so ein hübsches Geschenk nehme ich natürlich gern an, denn: was für ein schönes Buch! Es ist von Isabel Kranz und heißt „Sprechende Blumen. Ein ABC der Pflanzensprache“. Erschienen ist es in der Reihe „Naturkunden“, die von Judith Schalansky herausgegeben wird. Und damit ist dann wohl eh klar, dass es wunderschön ist, denn: Judith Schalansky. Wisster, ne? Namen merken, ist immer schön.

Rechts sind jeweils Zeichnungen der besprochenen Blumen zu sehen, links der Name in verschiedenen Sprachen, Art, Gattung und Familie, ein Zitat – und dann kommt eine kleine Geschichte zu dieser Blume, oder eine Erklärung. Über die Eisblumen etwa erzählt Isabel Kranz, wie Walter Benjamin am ersten Januar 1927 auf einem Bett in Moskau liegt und über sich und seine Liebe nachdenkt. Eisblumen kommen da eher am Rande vor, aber egal. Überhaupt, Eisblumen in ein solches Buch aufzunehmen, ist natürlich sowieso eine schöne Idee.
Und wegen dieser Geschichten heißt das Buch auch „Sprechende Blumen“: weil Blumen zwar nicht sprechen können, aber sie können durchaus eine Geschichte erzählen. Die Geschichten reichen von Monty Python bis zu Klassikern der Weltliteratur, wild durcheinander, erratisch, und gerade deswegen so wunderbar. Man fühlt sich fast ein bisschen an den „Atlas der abgelegenen Inseln“ erinnert. Von Judith Schalansky.
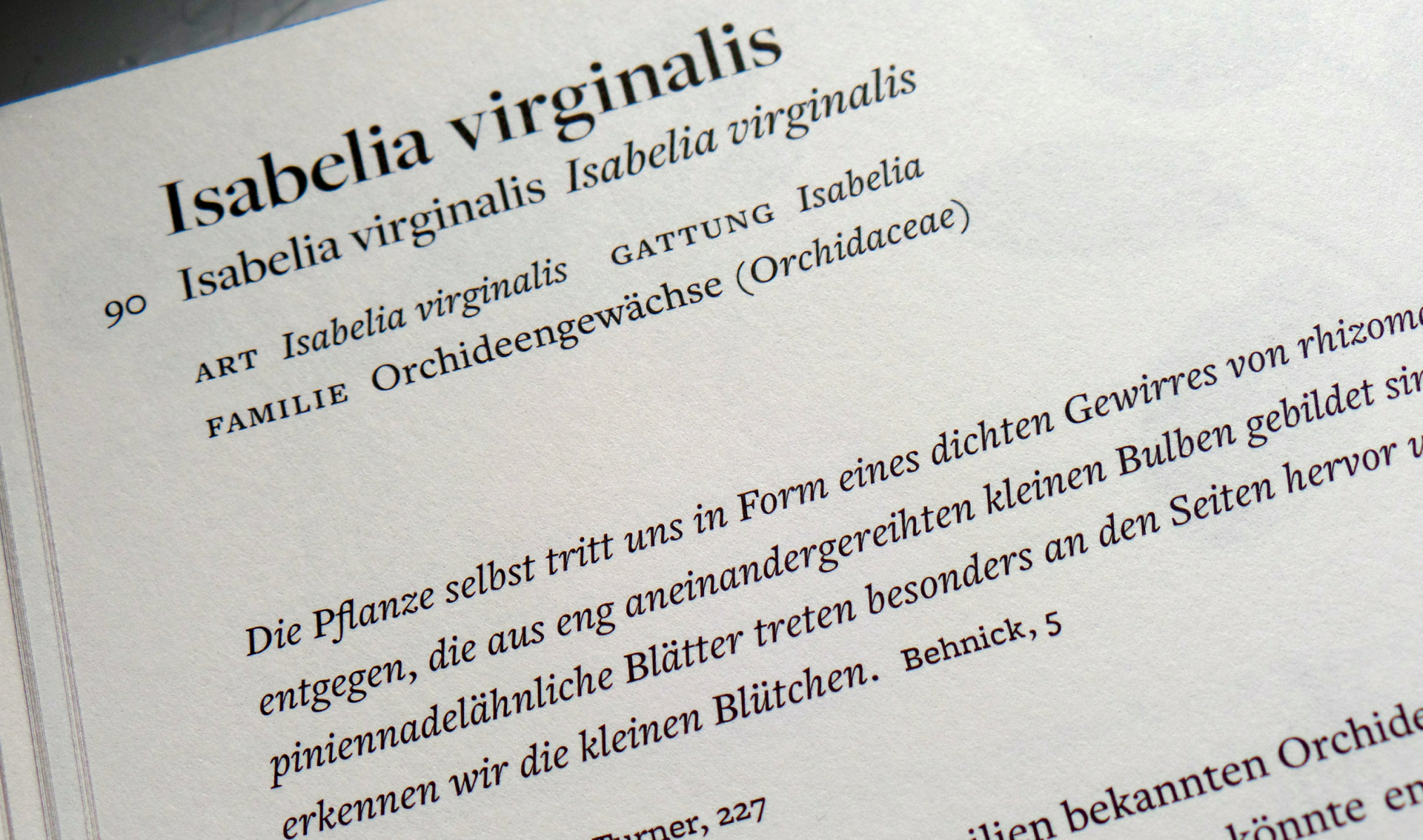
Ganz herzlichen Dank an den unbekannten Schenker oder die Schenkerin!
Isabel Kranz: Sprechende Blumen. Ein ABC der Pflanzensprache. Erschienen in der Reihe „Naturkunden“, Hg. Judith Schalansky, bei Matthes & Seitz. 32,- € und jeden Cent wert.
Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. / Bundessparte Übersetzer im Verband deutscher Schriftsteller (VS) in ver.di
————————————————————————————————————————— VDÜ – die Literaturübersetzer – Pressemitteilung [30.03.2014]
Mitgliederversammlung des Übersetzerverbandes nimmt Gemeinsame Vergütungsregeln an
Die Mitglieder des VdÜ, des Verbandes der Literaturübersetzer, haben auf ihrer gestrigen außerordentlichen Mitgliederversammlung den mit einer Gruppe von Verlagen ausgehandelten Vorschlag für eine Gemeinsame Vergütungsregel (GVR) mit deutlicher Mehrheit angenommen.
Zugleich haben die Mitglieder den Verbandsgremien des VdÜ aufgetragen, weitere Verlage zur Mitwirkung an der GVR zu gewinnen. Vergütungsregeln zweiter Klasse für Verträge mit Konzernverlagen dürfe es dabei nicht geben, so die Mitgliederversammlung.
Hinrich Schmidt-Henkel, 1. Vorsitzender des VdÜ:
„Mit dieser Vergütungsregel zeigen wir, dass eine von Sachkenntnis und gutem Willen getragene vernünftige Einigung möglich ist. Das langjährige Gezerre um die Definition von angemessener Mindestvergütung der Übersetzer ist damit einvernehmlich aufgelöst. Wir danken der Gruppe der beteiligten Verlage und gehen weiterhin auf andere Verlage zu mit der Einladung, sich der Vergütungsregel anzuschließen.“
Stephan D. Joß, Geschäftsführer des C. Hanser Verlags, München:
„Ich freue mich über diese Einigung, einen Interessensausgleich, mit der die Belange der Beteiligten weit besser geregelt sind, als jedes Gerichtsurteil es könnte. Mit der Annahme der Vergütungsregel durch den VdÜ steht die Tür für weitere Verlage offen.“
Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Bereichsleiter Kunst&Kultur bei ver.di.
„Wir haben hierin eine verlässliche, praxisorientierte Vergütungsregel, die ein solides Fundament geschaffen hat und einen Maßstab für alle Vertragsabschlüsse setzt.“
Die Erstunterzeichner: C. Hanser, München, Hanser Berlin und Nagel & Kimche, Frankfurter Verlagsanstalt (Joachim Unseld), Hoffmann & Campe Verlag, marebuch, Schöffling Verlag, Wallstein Verlag.
Diese Vergütungsregel verwirklicht erstmals für Literaturübersetzungen die Forderung der Urheberrechtsnovelle von 2002 nach gemeinsamen Regeln von Urhebern und Verwertern, mit denen eine angemessene Mindestvergütung definiert wird.
Die Beteiligten haben die GVR bei einer Pressekonferenz am heutigen Sonntag in Köln der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Text der Vergütungsregel ist bei der Pressestelle des Übersetzerverbandes erhältlich.
***
Hier das Börsenblatt dazu.
UPDATE: Hier ist der Text der gemeinsamen Vergütungsregeln.
Seit einer Weile kommen gelegentlich Nachrichten von gmx, ich solle auf SSL-Verschlüsselung umstellen, seit gestern gehen nur noch SSL-verschlüsselte Mails. Glücklicherweise hat der lustige Mann ebenfalls einen gmx-Account und liest solche Mails manchmal, und ebenso glücklicherweise gibt es bei gmx eine idiotensichere Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man tun muss, sonst hätte ich womöglich seit gestern keine Mails mehr bekommen. Wer liest denn schon Mails von gmx! Jedenfalls habe ich also alles artig gemacht, auf dem Computer und dem iPhone, allein: auf dem Phone funktioniert es nicht, ich kann keine Mails mehr versenden, seit ich das umgestellt habe. Empfangen geht problemlos. Beim Senden bekomme ich die Fehlermeldung:
Der Benutzername oder das Kennwort für SMTP:ibogdan(ät)gmx.de@mail.gmx.net ist nicht korrekt.
Stimmt aber nicht, Benutzername und Kennwort sind korrekt. Der Mann hat das gleiche Problem, eine Facebookbekannte hat es auch. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
Natürlich beantwortet dieses kleine Serviceblog auch gern die Fragen von Lesern, also von Leuten, die eigentlich gar keine Leserinnen sind, jedenfalls keine meines Blog, sondern mit irgendeiner Googlefrage hier gelandet sind. Als da wären:
thema freundschaft erhalten
Da sind Sie hier richtig, ich habe da einen Spezialtipp: Kleine Geschenke.
trottelmucke
Ich sachma so: mz-mz-mz-mz-mz-mz-mz-mz.
warum glaub ich dass ich klamoten brauche
Ich glaube, Du brauchst ein E, ein Komma und ein T. Alles andere braucht kein Mensch.
wie kann man dinge ein kleines bisschen besser machen
Willkommen im Club, das frage ich mich auch.
verteilung nett menschen
Keine Ahnung, folgt das auch so einer Gauß’schen Glockenkurve? Also, sehr viele mittelnette in der Mitte und sehr wenig echte Arschlöcher und echt gute Menschen an den Rändern?
isabel ich kann dich nicht vergessen
Ach, das tut mir jetzt leid. Oder soll ich sagen, oh, das freut mich? Man weiß es nicht. Ich hoffe, es ist eine angenehme Erinnerung, ich gehöre nämlich lieber zu den netten.
irgendwann werde ich hey zu dir sagen ohne
Ohne was? Das macht mich fertig, das ist ja, als würde im Zimmer über einem jemand abends beim Schlafengehen einen Schuh fallen lassen, und dann kann man selbst die ganze Nacht nicht schlafen, weil man auf den zweiten Schuh wartet. (Oder wie eine nicht zugemachte Klammer.
Hey zu mir sagen kann man natürlich immer gern.
hamster spieße esse machen
Das lohnt doch nicht, da ist doch nix dran.
depressiv, hochintelligent, lesbisch
Depressiv ist höchst unschön, aber behandelbar. Suchen Sie sich professionelle Hilfe, ehrlich. Hochintelligent und lesbisch hingegen: kommt vor, macht nix.
was kann man machen wenn man einen schauspieler liebt?
Kommt drauf an. Wenn man ihn kennt und mit ihm zusammenlebt und so: das gleiche wie mit anderen Berufen auch. Weiterlieben.
Wenn es um eine Schwärmerei auf der Leinwand geht: nochmal über „Liebe“ nachdenken.
wenn frauen ja sagen meinen sie nein
Das ist eine Fehlinformation. Wenn Frauen ja sagen, meinen sie ja, und wenn sie nein sagen, meinen sie nein. Das kann man sich gut merken, ja und ja fangen beide mit J an, nein und nein beide mit N. Crazy, aber wahr.
Kartoffeln
Zwiebel
Frischer Bärlauch
Pellkartoffeln kochen und je nach Schale und Vorliebe entweder pellen oder halt nicht. Während die Kartoffeln kochen, Zwiebel und Bärlauch kleinschneiden und vegane Mayonnaise zubereiten. Dafür braucht man:
100 ml Sojamilch
2 TL Zitronensaft
Salz
Pfeffer
2 TL Senf
125 ml Sonnenblumenöl
(Rezept von hier)
Sojamilch in einen hohen Becher geben, Zitronensaft dazu – laut Rezept soll das etwas gerinnen, tat es bei mir nicht, war aber egal. Womöglich lag es daran, dass ich keinen Zitronensaft hatte, sondern einmal Orangen-, einmal Pampelmusensaft genommen habe. Salz, Pfeffer und Senf dazu. Pürierstab reinstellen und los geht’s: beim Pürieren das Öl in einem dünnen Strahl zufließen lassen und schön weitermixen, bis die Mayo fest ist. Wenn sie nicht fest wird, noch etwas mehr Öl einrinnen lassen und weiterpürieren. Wird schon. Supereinfach, superlecker. Meine Mayo war sehr fest geworden und der Kartoffelsalat dadurch etwas trocken, deswegen habe ich noch einen Schluck Gemüsebrühe dazugegeben. Am besten einige Stunden vorher zubereiten, damit der Kartoffelsalat schön durchziehen kann.
Für Coleslaw geht die Mayo übrigens auch sehr gut.
So! lecker!